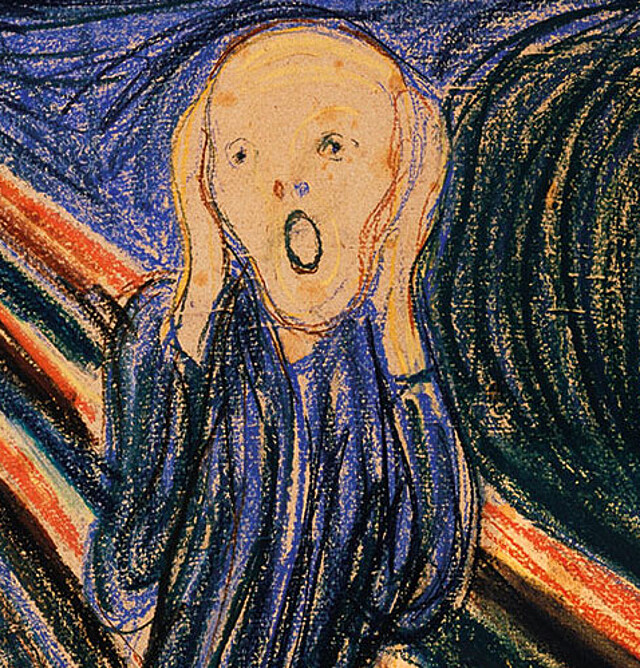Kirchensteuer: Wie wird sie berechnet und welche Formen gibt es?
Viele Menschen denken bei der Kirchensteuer vorrangig an Gelder, die an die Ev.-Luth. oder die katholische Kirche gezahlt werden. Tatsächlich können jedoch in Deutschland alle als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten Religionsgemeinschaften eine solche Steuer erheben, dazu zählen beispielsweise auch die altkatholische Kirche und einige jüdische Gemeinden.
Die Kirchensteuer wird üblicherweise als Prozentsatz der Einkommenssteuer festgelegt. In Hamburg und weiteren Teilen der Nordkirche beträgt sie einheitlich neun Prozent der Lohn- bzw. der Einkommensteuer.
Tatsächlich gibt es darüber hinaus verschiedene Formen der Kirchensteuer, die sich je nach Einkommensquelle und Lebenssituation unterscheiden können:
- Kirchenlohnsteuer: Eine Steuer, die auf den Lohn erhoben und vom Arbeitgeber direkt an das Finanzamt abgeführt wird. Der Abzug erfolgt über die Lohnsteuerkarte, auf der die Religionszugehörigkeit vermerkt ist.
- Kirchensteuer auf Kapitalerträge: Die Höhe der Kirchensteuer auf private Kapitalerträge (die über den Sparer-Pauschbetrag hinausgehen) liegt ebenfalls bei neun Prozent der Abgeltungssteuer und wird von Kreditinstituten zusammen mit der Abgeltungssteuer einbehalten.
- Kircheneinkommensteuer: Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder Vermietung sowie andere steuerpflichtige Einkünfte (neben der Lohnsteuer) werden ebenfalls kirchlich versteuert.
- Besonderes Kirchgeld: Ist nur die eine Eheperson Mitglied der Kirche und die andere nicht, wird das sogenannte besondere Kirchgeld erhoben. Es richtet sich nach dem „Lebensführungsaufwand“ des kirchenangehörigen Ehepartners, d. h. bei einem Kirchenmitglied, dessen Eheperson ein höheres Einkommen hat, geht man davon aus, dass sich der Lebensstandard des Kirchenmitglieds durch die Ehe erhöht hat.