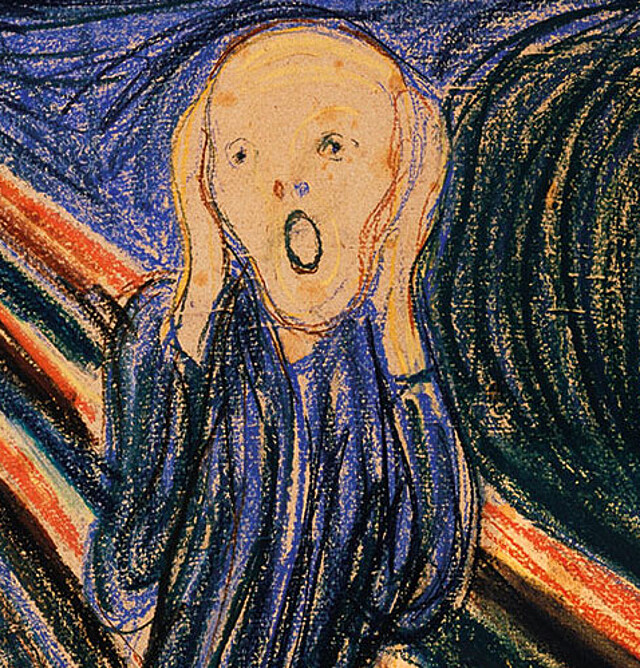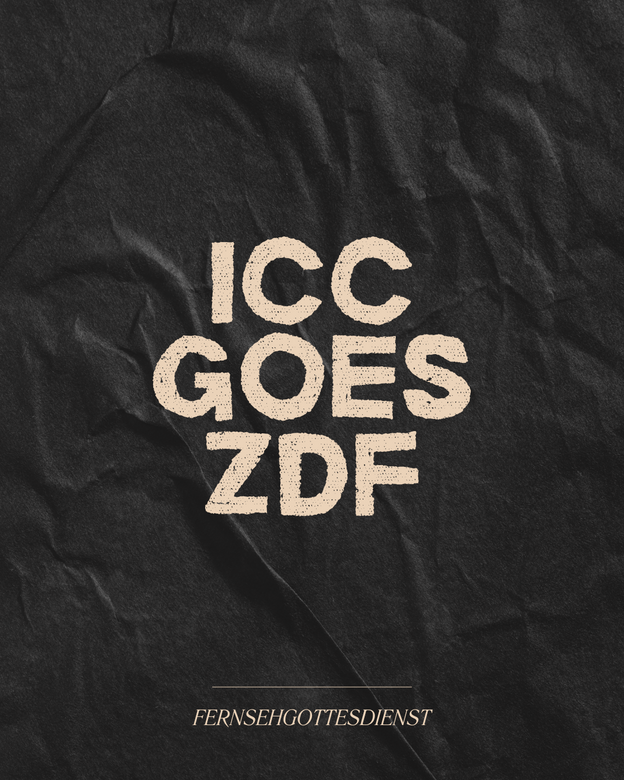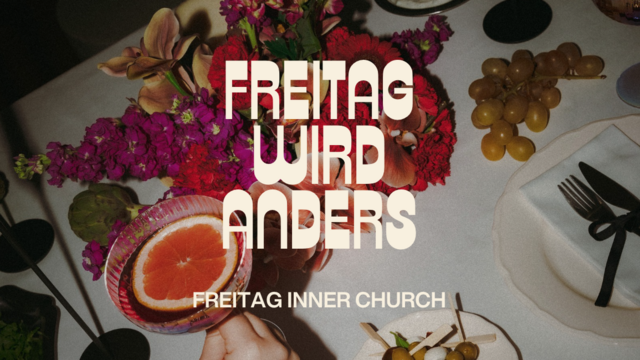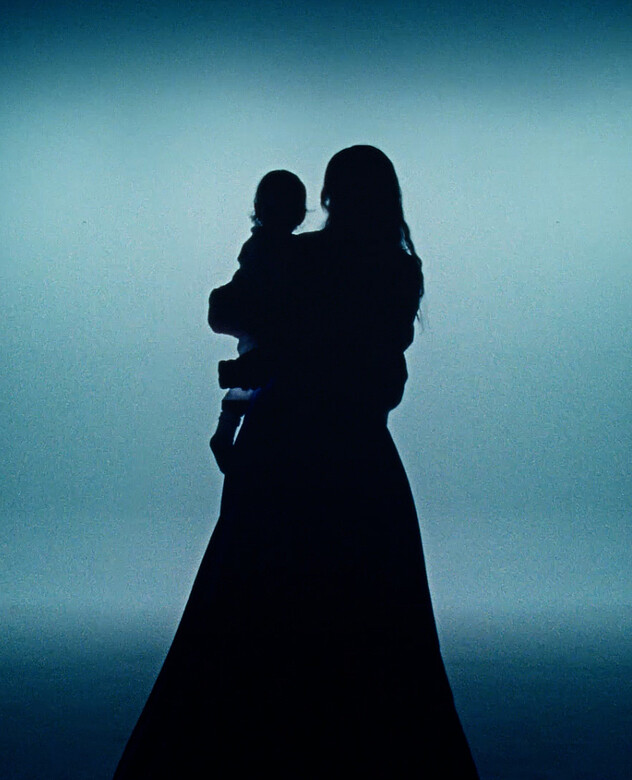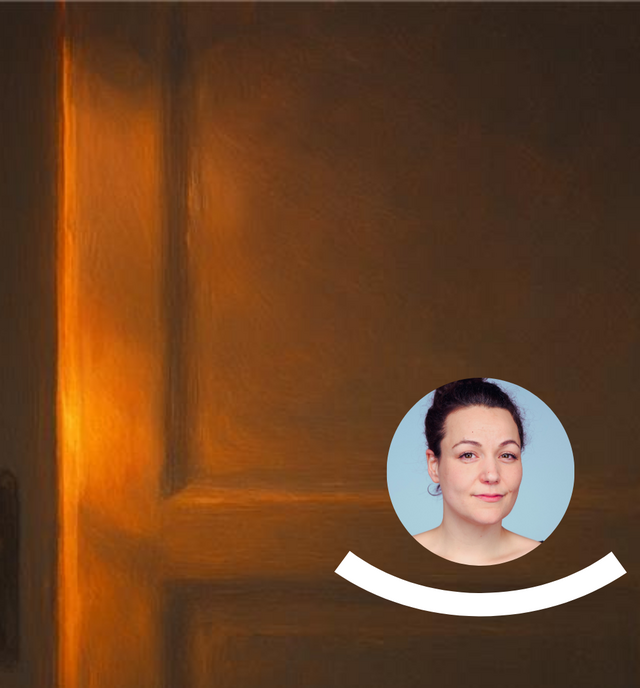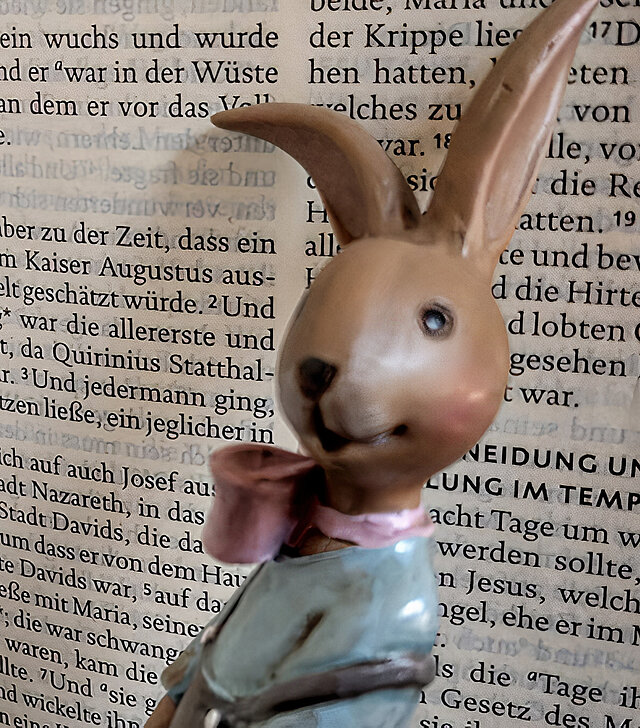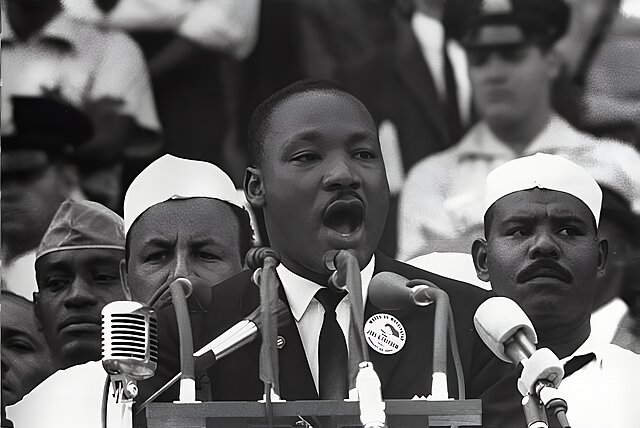Warum, wie viel und für was zahle ich eigentlich Kirchensteuer? Wir haben die häufigsten Fragen rund um ein wichtiges Fundament der Evangelischen Kirche zusammengetragen.
Häufige Fragen rund um das Thema Kirchensteuer
Mitglieder bestimmter Religionsgemeinschaften – zum Beispiel der Evangelischen Kirche in Hamburg – zahlen eine Abgabe. Das ist die Kirchensteuer! Sie finanziert kirchliche Arbeit, unter anderem Gottesdienste, Seelsorge und soziale Projekte. Sie ist eine der Säulen, die dazu beitragen, dass Kirche ihre wichtigen sozialen und geistlichen Aufgaben erfüllen kann.
Wer Mitglied der Evangelischen Kirche in Hamburg ist, zahlt Kirchensteuer. Das ist unabhängig davon, ob sich jemand aktiv im Gemeindeleben beteiligt. Denn in jedem Fall finanziert die eigene Abgabe den Erhalt wichtiger kirchlicher sowie sozialer Angebote, die allen Menschen zur Verfügung steht.
Die Kirchensteuer beträgt in Hamburg sowie anderen Teilen der Nordkirche neun Prozent der Lohn- bzw. Einkommenssteuer. Für die meisten Bundesländer ist das übrigens die Standardhöhe.
Wer Mitglied einer kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaft ist, ist zur Zahlung einer Kirchensteuer verpflichtet. Zumindest dann, wenn sie über steuerpflichtiges Einkommen verfügen. Kinder, Studierende und Arbeitslose zahlen keine Kirchensteuer.
Abhängig von der Höhe ihrer Rente oder sonstiger Einkünfte, können auch Rentner*innen dazu verpflichtet sein, Kirchensteuer zu zahlen. Ist das der Fall, wird die Kirchensteuer als Teil der Einkommenssteuer bemessen.
Anhand der jeweiligen Einkommensteuer wird die Kirchensteuer automatisch berechnet. Allerdings können Familien mit Kindern von Kinderfreibeträgen profitieren – die mindern das zu versteuernde Einkommen und senken somit automatisch die Kirchensteuerlast.
Ja! In Deutschland kann die Kirchensteuer als Sonderausgabe von der Einkommensteuer abgezogen werden. Das wiederum senkt das zu versteuernde Einkommen und damit auch die Steuerlast.
Eine Familie mit Kindern profitiert von Kinderfreibeträgen – die reduzieren das zu versteuernde Einkommen und das senkt die Höhe der Kirchensteuer. Es gibt darüber hinaus bestimmte Steuervergünstigungen für Familien und Alleinerziehende. Auch das wirkt sich indirekt auf die Höhe der Kirchensteuer aus.
Die Pflicht zur Abgabe einer Kirchensteuer beginnt, sobald man als Mitglied Einkommensteuer zahlt. Sie endet mit dem Ende der Mitgliedschaft – beispielsweise durch den Austritt, den Übertritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft oder dem Tod des Mitglieds.
Die Kirchensteuer wird für das laufende Jahr anteilig berechnet. Das heißt, dass lediglich die Monate vor dem Austritt berücksichtigt werden. Der Austritt beendet die Steuerpflicht mit dem folgenden Monatsende.
Die Abgabe der Kirchensteuer ist an die Mitgliedschaft gebunden – ein freiwilliger Kirchensteuerbeitrag ist somit nicht möglich. Allerdings können freiwillige Abgaben durch Spenden an kirchliche Einrichtungen geleistet werden – auch die lassen sich steuerlich übrigens geltend machen.
Nein, nur durch einen Kirchenaustritt ist eine Befreiung von der Kirchensteuer möglich, denn der entscheidende Faktor in einer steuererhebenden Kirche ist die Mitgliedschaft. Es gibt eine Ausnahme: Wenn jemand nachweislich kein einkommensteuerpflichtiges Einkommen hat, ist diese Person von der Kirchensteuer befreit.
Durch die Kirchensteuer wird kirchliche Arbeit mitfinanziert. Darunter fallen beispielsweise Gottesdienste und Seelsorge, aber auch eine Vielzahl von sozialen Projekten, wie Kindergärten, Beratungsstellen, Obdachlosenhilfe und viele weitere.
Die Kirchensteuer wird in Hamburg – und in vielen anderen Bundesländern auch – von den staatlichen Finanzämtern eingezogen und an die Kirche weitergeleitet. Für diese Arbeit zahlt die Kirche eine Verwaltungsgebühr an das Finanzamt.
Der Einzug der Kirchensteuer durch das Finanzamt ist historisch bedingt. Darüber hinaus ist der Vorgang auf diese Weise auch für Steuerzahler*innen bequemer, denn die Kirchensteuer wird automatisch im Rahmen der Einkommens- oder Lohnsteuerberechnung einbezogen.
Innerhalb Deutschlands bleibt auch nach einem Umzug die Kirchensteuerpflicht bestehen. Sie ist an die Mitgliedschaft gebunden und gilt in allen Bundesländern.
Zieht ein Kirchenmitglied in ein anderes Land innerhalb oder außerhalb der EU, entfällt die Kirchensteuerpflicht in Deutschland. Zumindest dann, wenn das steuerpflichtige Einkommen aus Deutschland wegfällt.
Einen gewissen Teil des Einkommens zur Unterstützung an die Kirche abzugeben, ist nicht neu: Das „Kirchenzehnte“ gab es schon vor hunderten von Jahren. Die Französische Revolution, die Auflösung des engen Verhältnisses zwischen Regierung und Kirche und weitere politische Faktoren führten zu der Notwendigkeit einer unabhängigen Selbstversorgung – die letztlich in der Entstehung der Kirchensteuer mündete.
Einkommen aus Lohn und Gehalt, Kapitalerträge über dem Sparfreibetrag sowie Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Vermietung und anderen Quellen sind kirchensteuerpflichtig (im Rahmen der Kirchenlohn- bzw. der Kircheneinkommensteuer).
Ist bei einem Ehepaar ein Teil kirchensteuerpflichtig und der andere nicht, wird das besondere Kirchgeld erhoben. Es richtet sich nach dem gemeinsamen Einkommen und ist nach Einkommensstufen gestaffelt.